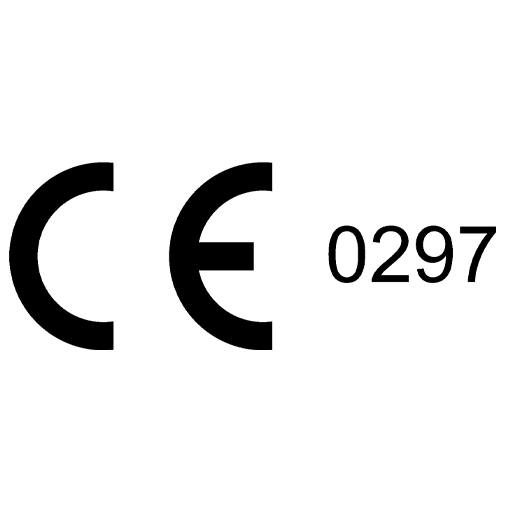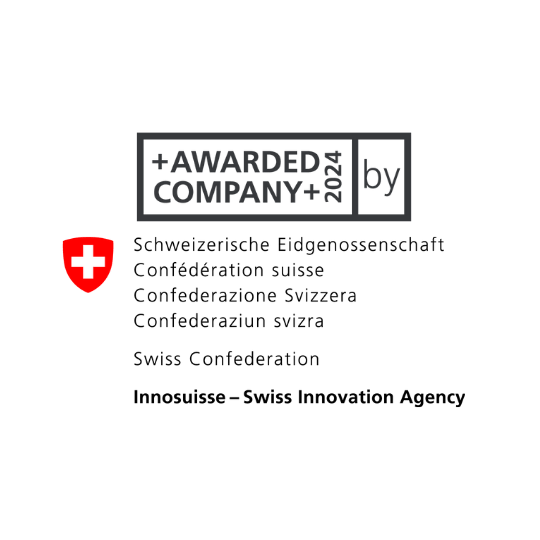Selbst wenn RadiologInnen nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, lassen sich Fehldiagnosen nie völlig vermeiden. Da der radiologische Befund oft die Weichen für die anschließende Therapie stellt, können falsche oder verspätete Diagnosen aber potenziell großen Schaden anrichten. Hier klären wir die wichtigsten Haftungsfragen und erörtern fünf Strategien, um die Fehlerquote in der Radiologie möglichst gering zu halten.
Wann spricht man in der Radiologie von einer Fehldiagnose?
Eine Fehldiagnose liegt vor, wenn bildgebende Untersuchungen wie Röntgen, MRT oder CT falsch ausgewertet werden. Dabei lassen sich drei Irrtumsmöglichkeiten unterscheiden:
- RadiologInnen können pathologische Veränderungen wie Knoten oder Verschattungen auf einem Röntgenbild übersehen.
- Umgekehrt können Normalbefunde als pathologisch fehlgedeutet werden (z.B. wenn die Epiphysenlinie am Röntgenbild eines Kindes für eine Fraktur gehalten wird).
- Manchmal erkennen RadiologInnen zwar eine pathologische Veränderung, deuten sie aber falsch (z.B. wird ein Karzinom mit einer harmlosen, nicht behandlungsbedürftigen Zyste verwechselt).
In einem viel beachteten Report hat die US-amerikanische National Academy of Science, Engineering, and Medicine (NASEM) eine weiter gefasste Definition von Fehldiagnosen erarbeitet: Demnach liegt ein Diagnosefehler vor, wenn es nicht gelingt,
- (a) eine exakte und zeitgerechte Erklärung für die Gesundheitsprobleme von PatientInnen zu finden, oder
- (b) die Diagnose den PatientInnen (verständlich) zu kommunizieren.
Mit dieser patientenzentrierten Definition hat die NASEM den Finger auf zwei weitere wunde Punkte in unserem Gesundheitssystem gelegt: Diagnosen werden manchmal verspätet gestellt oder es hapert an der Kommunikation zwischen Radiologie, Zuweisern oder PatientInnen. Auch dadurch kann es zu suboptimalen Behandlungsergebnissen kommen.
Wie wahrscheinlich sind Fehldiagnosen in der Radiologie?
Nach konservativen Schätzungen beträgt die Fehlerquote bei bildgebenden Untersuchungen im Schnitt rund 3 bis 5 Prozent – das ergibt weltweit rund 40 Millionen Fehldiagnosen pro Jahr. Je nach konkreter Untersuchung und je nach äußeren Rahmenbedingungen können die Fehlerquoten offenbar erheblich schwanken.
Doch obwohl es viel Forschung auf diesem Gebiet gibt, ist es methodisch nicht leicht, die Fehlerquote bei radiologischen Untersuchungen exakt zu bestimmen. Das liegt auch daran, dass Röntgen-, CT- oder MRT-Aufnahmen manchmal nicht eindeutig interpretierbar sind und es sich damit oft nur um vorläufige Diagnosen handelt. Selbst wenn sich eine Verdachtsdiagnose im Nachhinein als falsch herausstellt, muss sie doch zum Zeitpunkt der Untersuchung keine „Fehldiagnose“ darstellen.
Was tun, wenn der Vorwurf einer Fehldiagnose erhoben wird?
Wenn PatientInnen glauben, dass sie durch eine Fehldiagnose zu Schaden gekommen sind, haben sie die Möglichkeit, eine Zivilklage einzureichen. Faktisch ziehen die meisten PatientInnen jedoch nicht sofort vor Gericht, sondern wenden sich zunächst an außergerichtliche Stellen. In der Schweiz dienen beispielsweise die Ombudsstellen der kantonalen Ärztegesellschaften oder die Gutachterstelle des Berufsverbands FMH als unabhängige Beschwerde- und Vermittlungsinstanzen. Zwischen 1982 und 2022 hat die FMH-Gutachterstelle insgesamt 60 Gutachten zu möglichen Fehlern in der Radiologie erstellt, wobei in 16 dieser Fälle eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflichten bestätigt wurde.
Radiologische Einrichtungen sollten bei Vorwürfen im ersten Schritt die Berufshaftpflichtversicherung kontaktieren, die in der Schweiz für alle praktizierenden ÄrztInnen obligatorisch ist. Die Berufshaftpflichtversicherungen übernehmen einerseits berechtigte Schadenersatzansprüche von PatientInnen, andererseits wehren sie unberechtigte Ansprüche ab (passiver Rechtsschutz). Auch die Kosten für medizinische Gutachten werden übernommen, sofern der Versicherungsträger Mitglied des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) ist.
Eine gute Kommunikation mit PatientInnen oder ihren Angehörigen kann die Situation bei konkreten Vorwürfen oft entschärfen. Doch Vorsicht: PatientInnen haben zwar jederzeit das Recht, eine Kopie ihrer Patientenakten ausgehändigt zu bekommen und Details zum Diagnose- oder Behandlungsablauf zu erfragen. Die Versicherungspolicen von Haftpflichtversicherungen verbieten ÄrztInnen jedoch häufig, einen Fehler einzugestehen oder ein Verschulden anzuerkennen. Das heißt, die eigenen Handlungen sollten neutral beschrieben, nicht aber bewertet werden.
Wann haften RadiologInnen für falsche Diagnosen?
Obwohl Fehldiagnosen in der Radiologie regelmäßig und häufig vorkommen, führen sie doch nur vergleichsweise selten zu tatsächlichen Verurteilungen. Denn eine Fehldiagnose als solche begründet nicht automatisch eine Arzthaftung. In fast allen westlichen Rechtsordnungen gilt als entscheidend, ob ÄrztInnen eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten zur Last gelegt werden kann.
Das bedeutet: RadiologInnen schulden ihren PatientInnen nicht die richtige Diagnose, sondern „nur“ ein Lege-artis-Vorgehen nach dem jeweils aktuellen Stand der ärztlichen Kunst. Kommt es dabei zu einem diagnostischen Irrtum, der für GutachterInnen nachvollziehbar erscheint, so zieht dieser in der Regel keine zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen nach sich.
Eine oft knifflige juristische Frage ist, wer bei einem Angestelltenverhältnis für eine Fehldiagnose haftet: der Radiologe bzw. die Radiologin, der Arbeitgeber als juristische Person? Details können sich zwar von Kanton zu Kanton unterscheiden. Normalerweise gilt aber: Selbstständig tätige RadiologInnen haften selbst, bei angestellten ÄrztInnen (z.B. in Gruppenpraxen oder Krankenhäusern) haftet das Unternehmen. Bei grobem Verschulden kann der Arbeitnehmer MitarbeiterInnen zwar in Regress nehmen, faktisch geschieht dies jedoch selten.
Fehlerquoten senken: 5 Strategien zur Risikoreduktion
Fehldiagnosen sind in der Radiologie nie absolut vermeidbar. Im Gegenteil, es handelt sich um regelmäßige und vorhersehbare Ereignisse, die nicht als persönliches Versagen einzelner Personen gewertet werden sollten. Sinnvoller ist eine neutrale und objektive Herangehensweise, um die Gründe besser zu verstehen und darauf aufbauend Strategien zur Risikosenkung zu entwickeln. Das können radiologische Einrichtungen zur Senkung ihrer Fehlerquoten tun:
1. Systembedingte Ursachen für Fehldiagnosen klären
Fehldiagnosen werden oft durch systembedingte Faktoren begünstigt, auf die der einzelne Arzt oder die Ärztin nur bedingt Einfluss hat. Dazu zählen etwa Personalmangel, ein hoher Workload, überlange Dienstzeiten, häufige Ablenkungen, eine mangelnde Standardisierung von Prozessen oder unklare Aufgaben- und Kompetenzverteilungen im Team. Auch wenn es oft nicht leicht ist, suboptimale Rahmenbedingungen sofort zu verändern, sollten sich radiologische Einrichtungen dieser Schwachstellen bewusst sein und Schritt für Schritt Lösungen erarbeiten.
2. Kommunikationsprozesse optimieren
Radiologische Einrichtungen sind meist komplexe Organisationen und dadurch besonders anfällig für Kommunikationsprobleme. Diese können zur Folge haben, dass wichtige Informationen versickern, Diagnosen verspätet gestellt werden oder zuweisende Stellen und PatientInnen keine klaren Informationen erhalten. Eine Standardisierung und Optimierung von Kommunikationsprozessen trägt daher wesentlich dazu bei, die Quoten von Fehldiagnosen in der Radiologie zu senken. Wichtige Instrumente sind etwa multidisziplinäre Team-Konferenzen, Fallbesprechungen, Checklisten, Peer Reviews, strukturierte Reporte oder elektronische Patientenakten.
3. Sich möglicher kognitiver Verzerrungen bewusst sein
Auf individueller Ebene setzt die radiologische Diagnostik komplexe Wahrnehmungs- und Denkprozesse voraus, die jedoch störungsanfällig sind. Gerade unter Bedingungen wie Stress und Zeitdruck besteht ein latentes Risiko für kognitive Verzerrungen (Biases) – und damit für Fehldiagnosen.
Typische Beispiele für kognitive Verzerrungen sind:
- Satisfaction of search: Damit ist die Tendenz gemeint, den Diagnoseprozess vorschnell zu beenden, sobald eine Auffälligkeit entdeckt wurde, die die Beschwerden der Patientin einigermaßen plausibel erklärt. Eine zusätzliche Verschattung am Rand des Röntgenbildes wird dann unter Umständen übersehen.
- Anchoring bias: Man nimmt die zuerst verfügbaren Informationen für wichtiger und hält (unbewusst) daran fest, auch wenn später erhaltene Informationen dem ersten Eindruck widersprechen.
- Availability bias: Weil ein bestimmtes Krankheitsbild geistig abrufbar ist, wird es für wahrscheinlicher gehalten. Man hat beispielsweise eine Diagnose am Vortag gestellt und bei einem klinisch ähnlichen Muster kommt sie sofort wieder ins Gedächtnis.
- Attribution bias: Bestimmte Zuschreibungen an PatientInnen (wie „alkoholkrank“, „depressiv“, „adipös“) können den Blickwinkel einengen und dazu führen, dass ÄrztInnen nicht mehr neutral und objektiv urteilen.
Kognitive Verzerrungen sind nicht immer vermeidbar, insbesondere dann, wenn unter Zeitdruck gearbeitet werden muss. Das Wissen darüber kann jedoch helfen, innerlich einen Schritt zurückzutreten und eigene Denkprozesse zu reflektieren. Zusätzliche Unterstützung bieten beispielsweise Checklisten, Peer-Review-Systeme oder technologische Assistenzsysteme.
4. Auf mentale und visuelle Ermüdung achten
Von kognitiven Verzerrungen zu unterscheiden ist mentale oder visuelle Ermüdung, die nachweislich die Urteilsfähigkeit beeinträchtigt und Fehldiagnosen begünstigen kann. Ermüdung hat physiologische Ursachen: Selbst wenn sich individuelle Belastungsgrenzen durch Training beeinflussen lassen, ist das menschliche Gehirn grundsätzlich nicht fähig, über viele Stunden hinweg fehlerlos zu arbeiten. Zur Risikoreduktion können folgende Strategien beitragen:
- sich anspruchsvolle Fälle zu Beginn einer Schicht vornehmen
- strukturierte kurze Pausen einlegen oder zwischen verschiedenen Tätigkeiten wechseln
- Störungen und Ablenkungen so weit wie möglich reduzieren
- den Arbeitsplatz optimieren (Ergonomie, Beleuchtung, etc.)
- technologische Assistenzsysteme nutzen
5. Moderne Gesundheitstechnologien zur Vermeidung von Fehldiagnosen nutzen
Innovative Gesundheitstechnologien tragen entscheidend dazu bei, die Fehlerquote in der Radiologie zu senken und damit die Patientensicherheit zu erhöhen. Ein Beispiel ist die digitale Brust-Tomosynthese, die laut Studien eine höhere Spezifität im Vergleich zur herkömmlichen Röntgen-Mammographie bietet und dadurch hilft, falsch-positive Befunde zu vermeiden.
Technologische Assistenzsysteme, etwa auf der Basis Künstlicher Intelligenz, leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag, um „typisch menschliche“ Fehlerquellen wie kognitive Verzerrungen oder Ermüdung zu kompensieren. Sie können damit gleichermaßen Effizienz und Patientensicherheit im klinischen Alltag erhöhen und die Gefahr von Fehldiagnosen verringern.
Offener und konstruktiver Umgang mit Fehldiagnosen ist entscheidend
Fehldiagnosen in der Radiologie entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel systembedingter und individueller Ursachen. Sie sind im klinischen Alltag nie völlig vermeidbar. Zur Minimierung von Fehlerquoten und Haftungsrisiken ist es jedoch wichtig, sich mögliche Ursachen bewusst zu machen und Strategien zu entwickeln, um diagnostische Entscheidungsprozesse zu verbessern. Eine Voraussetzung dafür ist ein neutraler und konstruktiver Umgang mit Fehlern. Denn eine „Blame and Shame“-Mentalität, die einzelnen Personen die Schuld für Fehler zuschiebt, lässt sich weder wissenschaftlich begründen, noch trägt sie zur Reduktion von Fehldiagnosen bei.