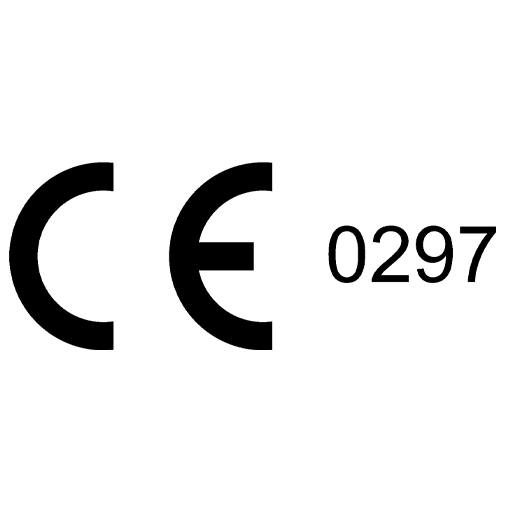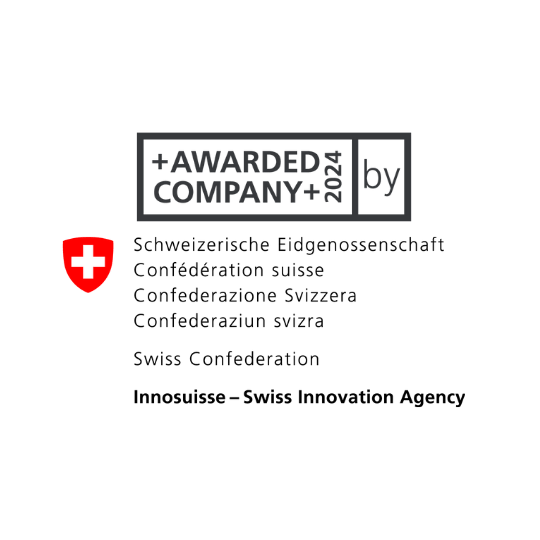Das absolute Brustkrebsrisiko beträgt für Frauen in den USA und in Europa rund 13 Prozent. Mit anderen Worten, etwa 1 von 8 Frauen erhält im Laufe ihres Lebens die Diagnose Brustkrebs. Doch die individuelle Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, variiert von Frau zu Frau. Aus der Wissenschaft sind mittlerweile zahlreiche Risikofaktoren bekannt, von denen einige potenziell beeinflussbar sind, andere wiederum nicht. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung – und welche Konsequenzen sich daraus für die Brustkrebs-Früherkennung ergeben.
Brustkrebsrisiko: Diese Einflussfaktoren sind nicht beeinflussbar
Der mit Abstand wichtigste unbeeinflussbare Risikofaktor ist das weibliche Geschlecht: Weniger als 1 % aller Brustkrebs-Fälle betreffen Männer. Bei Frauen steigt das allgemeine Brustkrebsrisiko in erster Linie mit dem Alter, darüber hinaus spielen genetische und hormonelle Faktoren sowie vorangegangene Strahlentherapien eine Rolle. Je nach Subtyp des Mammakarzinoms können diese Risikofaktoren unterschiedlich gewichtet sein.
Lebensalter bestimmt über die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken
Wie bei den meisten Krebsarten steigt das Brustkrebsrisiko mit zunehmendem Alter: Während das 10-Jahres-Risiko einer 20-jährigen Frau bei nur etwa 0,1 % liegt, erhalten 70- bis 79-jährige Frau mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 4 % eine Brustkrebs-Diagnose. Ab 80 Jahren fällt die Häufigkeit leicht ab, was möglicherweise mit den geringeren Screening-Raten in dieser Altersgruppe zu tun hat. Nach Angaben der American Cancer Society erkranken Frauen in den USA im Median mit 62 Jahren. Allerdings gibt es auch Subtypen mit abweichender Altersverteilung, wie etwa das triple-negative Mammakarzinom, das gehäuft bei Frauen unter 40 Jahren auftritt.
Genetische Faktoren können das Brustkrebsrisiko erheblich erhöhen
Dass Brustkrebs und auch Eierstockkrebs familiär gehäuft auftreten, ist seit langem bekannt. Auch die Ursachen und Hintergründe versteht die Forschung heute zunehmend besser. Mittlerweile wurden über 300 genetische Faktoren identifiziert, die das Brustkrebsrisiko teils moderat, teils erheblich erhöhen. Zu den bekanntesten zählen Mutationen der Tumorsuppressorgene BRCA-1 und BRCA-2. Bis zu 70 % aller Frauen mit Veränderungen in den BRCA-1/2-Genen erkranken im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Andere, seltenere Hochrisikogene sind beispielsweise CDH1, TP53, PTEN oder PALB2. Daneben ist eine Reihe an genetischen Variationen bekannt, die das Brustkrebsrisiko gering bis moderat erhöhen.
Brustdichte fördert Brustkrebsrisiko
Brustkrebs entwickelt sich überwiegend vom Brustdrüsengewebe aus. Frauen mit hoher Brustdichte, also einem hohen relativen Anteil an mammographisch dichtem Brustdrüsengewebe, erkranken daher häufiger an Brustkrebs. Je nach Studie erhöht sich das Brustkrebsrisiko um den Faktor 2 bis 4. Entscheidend ist aber auch: Dichtes Brustgewebe kann die Erkennung von Brustkrebs und seinen Vorstufen bei der konventionellen Mammographie erheblich erschweren.
Hormonelle Faktoren stehen im Zusammenhang mit Hormonrezeptor-positivem Mammakarzinom
Zahlreiche Studien legen nahe, dass die Anzahl an Menstruationen im Laufe des Lebens einer Frau das Brustkrebsrisiko beeinflusst: Eine frühe Menarche und eine späte Menopause sowie eine geringe Anzahl an Schwangerschaften erhöhen offenbar das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, wobei dieser Zusammenhang vor allem für das Hormonrezeptor-positive Mammakarzinom zutrifft. Maßgeblich dürfte dabei der lebenslange Hormonspiegel sein. Bei Frauen nach der Menopause ist ein höherer Spiegel an endogenen Geschlechtshormonen offenbar mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko assoziiert. Allerdings könnten die erhöhten Hormonwerte teils eine Folge anderer, potenziell beeinflussbarer Risikofaktoren wie Übergewicht oder Alkoholkonsum sein.
Vorangegangene Strahlentherapien und offenbar auch Chemotherapien
Da ionisierende Strahlung eine potenziell erbgutschädigende Wirkung hat, können Bestrahlungen im Kindes-, Jugend- oder frühen Erwachsenenalter das Brustkrebsrisiko erhöhen – vor allem, wenn dabei der Brustraum bestrahlt wird. Betroffen sind beispielsweise Frauen, die in ihrer Jugend aufgrund eines Hodgkin-Lymphoms behandelt wurden.
Wie stark das Brustkrebsrisiko steigt, hängt von einer Reihe individueller Faktoren ab: etwa von der Bestrahlungstechnik, der genauen Lage des bestrahlten Bereichs, der kumulierten Strahlendosis und dem genauen Zeitpunkt der Behandlung. Das Risiko ist besonders hoch, wenn die Bestrahlung stattfand, während das Brustdrüsengewebe in Entwicklung war.
Erhöhte Krebsraten bestehen auch unter Frauen, die in ihrer Jugend aufgrund einer Leukämie oder eines Sarkoms behandelt wurden. Offenbar wirken nicht nur Bestrahlungen, sondern auch Chemotherapien risikoerhöhend.
Lebensstil und Brustkrebsrisiko: Potenziell beeinflussbare Risikofaktoren
Neben diesen schicksalhaften Einflussfaktoren spielt aber auch der individuelle Lebensstil einer Frau eine Rolle beim Brustkrebsrisiko. Eindeutige Belege gibt es für die risikoerhöhende Wirkung von Hormontherapien, Übergewicht, Alkohol- und Nikotinkonsum sowie Bewegungsmangel. Für andere Faktoren wie Umweltschadstoffe, Nachtarbeit oder dem sozioökonomischen Status ist die Datenlage bisher unklar.
Kontrazeptiva und Hormontherapien: Nutzen und Risiko mit ÄrztInnen abwägen
Eine Reihe an Studien hat gezeigt, dass hormonelle Verhütungsmittel das Brustkrebsrisiko um rund 20 % erhöhen – insbesondere dann, wenn Frauen sie vor der ersten Schwangerschaft einnehmen. Da das absolute Erkrankungsrisiko bei jungen Frauen jedoch sehr gering ist, dürften insgesamt nur wenige Brustkrebsfälle auf das Konto der „Pille“ gehen. Nach dem Absetzen der Kontrazeptiva sinkt das Risiko wieder und gleich sich nach spätestens 10 Jahren an den altersentsprechenden Durchschnitt an.
Viel diskutiert wurde in den letzten Jahrzehnten über den Einfluss von Hormonersatzpräparaten, die Beschwerden in der Postmenopause lindern sollen. Nachdem in mehreren Metaanalysen nachgewiesen wurde, dass vor allem Östrogen-Gestagen-Kombinationspräparate die Entstehung von (Östrogenrezeptor-positivem) Brustkrebs fördern, ging die Verschreibungsrate deutlich zurück. Neuere Studien bestätigen diesen Zusammenhang, zeigen jedoch ein differenzierteres Bild. Demnach kommt es auch auf Zeitpunkt und Dauer der Hormonersatztherapie sowie die Art des Präparats an. Eine kurzfristige Einnahme gering dosierter Kombinationspräparate zur gezielten Behandlung von Wechseljahresbeschwerden dürfte das Brustkrebsrisiko nur moderat erhöhen. In jedem Fall sollten ÄrztInnen gemeinsam mit Betroffenen Nutzen und Risiken genau abwägen.
Übergewicht ist indirekt an Krebsentstehung beteiligt
Nach der Menopause ist das weibliche Fettgewebe der wichtigste Entstehungsort für Östrogen. Übergewicht beeinflusst daher indirekt den Hormonspiegel und wirkt sich so auch auf das Brustkrebsrisiko aus. Vor allem nach der Menopause erhöht ein Body-Mass-Index von ≥ 25 das Risiko, an hormonabhängigem Brustkrebs zu erkranken. Bei jüngeren Frauen ist der Zusammenhang weniger eindeutig. Möglicherweise könnte bei übergewichtigen Frauen auch ein erhöhter Insulin-Spiegel an der Krebsentstehung beteiligt sein.
Bewegungsmangel wirkt sich ungünstig auf Brustkrebsrisiko aus
Gut belegt ist, dass regelmäßige körperliche Aktivität einen gewissen schützenden Effekt hat, und zwar unabhängig vom Body-Mass-Index. Um rund 10 bis 20 % sinkt das Brustkrebsrisiko, wenn Frauen mindestens 3 bis 5 Stunden wöchentlich moderaten Ausdauersport betreiben. Die ursächlichen Mechanismen dahinter sind unklar. Möglicherweise hat Bewegung aber einen günstigen Einfluss auf Hormonwerte, Entzündungsprozesse und immunologische Faktoren.
Alkoholkonsum: Zusammenhang nicht völlig geklärt
Alkoholkonsum erhöht das Brustkrebsrisiko Studien zufolge um rund 7 – 10 % pro 10 Gramm Alkohol täglich – das entspricht etwa einem alkoholischen Getränk. Auch hier ist der ursächliche Zusammenhang nicht völlig geklärt. Vermutlich beeinflusst der Alkoholkonsum den endogenen Östrogenspiegel, eventuell haben Alkohol und dessen Abbauprodukte aber auch eine direkte karzinogene Wirkung.
Tabakkonsum hat eindeutigen Bezug zum Brustkrebsrisiko
Zigarettenrauch enthält zahlreiche karzinogene Substanzen, die bekanntlich das allgemeine Krebsrisiko erhöhen. Auch für das Brustkrebsrisiko ist der Zusammenhang eindeutig belegt. Der Effekt ist offenbar dosisabhängig und steigt mit der Anzahl an Zigaretten und Raucherjahren. Einige Studien deuten darauf hin, dass auch Passivrauchen einen Risikofaktor darstellt, insbesondere wenn Frauen der Rauchbelastung in der Kindheit und Jugend ausgesetzt waren.
Wie mit individuellem Brustkrebsrisiko umgehen?
Die individuelle Risikokonstellation in der Früherkennung angemessen zu berücksichtigen, stellt derzeit noch eine große Herausforderung dar. Staatlich organisierte Brustkrebs-Screening-Programme orientieren sich im Wesentlichen am Alter der Frau, lassen andere Risikofaktoren aber außer Acht. Dadurch werden die Programme dem individuellen Bedarf oft nicht gerecht: Einige Frauen werden möglicherweise zu häufig untersucht, während andere nicht rechtzeitig Zugang zu den Screenings erhalten.
Screening-Programme, die das individuelle Brustkrebsrisiko berücksichtigen, könnten den Nutzen für die einzelne Teilnehmerin erhöhen. In vielen Ländern, etwa den USA, Niederlanden oder Spanien, laufen derzeit Forschungsprogramme, die sich mit risikobasierten Screening-Strategien auseinandersetzen. Dabei stellen sich viele offene Fragen, wie etwa:
- Welche Vorhersagemodelle eignen sich zur Ermittlung des individuellen Brustkrebsrisikos?
- Wie können Frauen über ihr persönliches Risiko angemessen aufgeklärt werden?
- Anhand welcher Schwellenwerte sollte die Definition von Risikogruppen erfolgen?
- Wie kann die organisatorische Umsetzung risikobasierter Screening-Programme gelingen?
Noch sind zu viele Aspekte ungeklärt, um risikoadaptierte Screening-Strategien auf breiter Basis umzusetzen. ÄrztInnen können Frauen jedoch auf individueller Basis über ihr Brustkrebsrisiko aufklären, die Teilnahme an den staatlichen Screening-Programmen empfehlen und gegebenenfalls über erweiterte Früherkennungs-Maßnahmen beraten.
Brustkrebs-Screening-2.0 mit technologischer Unterstützung
Auch ein individuell stark erhöhtes Brustkrebsrisiko muss die Lebenserwartung von Frauen heute nicht wesentlich einschränken. Denn engmaschige Früherkennungs-Maßnahmen ermöglichen es, Brustkrebs in sehr frühen Stadien aufzuspüren, in denen gute Heilungschancen bestehen. Die klassische digitale Mammographie spielt hierbei nach wie vor eine Schlüsselrolle, wird aber zunehmend durch moderne Verfahren wie Tomosynthese oder Brust-MRT ergänzt.
Auch Assistenzsysteme auf der Basis Künstlicher Intelligenz (KI) haben großes Potenzial, um die Brustkrebs-Früherkennung in der Zukunft sicherer und effizienter zu gestalten. Selbstlernende Software kann bösartige Veränderungen auf Mammographie-Aufnahmen mit hoher Präzision erkennen – und erleichtert RadiologInnen somit die rasche und präzise Auswertung großer Mengen an Bilddaten. Auch als Instrument zur Risikobewertung werden KI-Tools im experimentellen Rahmen bereits eingesetzt. All das kann dazu beitragen, Frauen in Zukunft noch gezielter zu untersuchen und den individuellen Nutzen der Screenings zu erhöhen.
Patientinnen benötigen qualifizierte Information über persönliches Brustkrebsrisiko
Im klinischen Umfeld erscheint es derzeit vor allem wichtig, dass ÄrztInnen über die aktuelle Datenlage zum Brustkrebsrisiko gut informiert sind, um Frauen individuell qualifiziert beraten zu können. Vor allem bei positiver Familienanamnese kann ein Test auf bekannte Genveränderungen sinnvoll sein. Doch auch weitere, vor allem lebensstilbedingte Risikofaktoren sollten bei der Beratung berücksichtigt werden. Auf dieser Basis können Frauen eine informierte Entscheidung über ihre persönliche Gesundheitsvorsorge treffen.