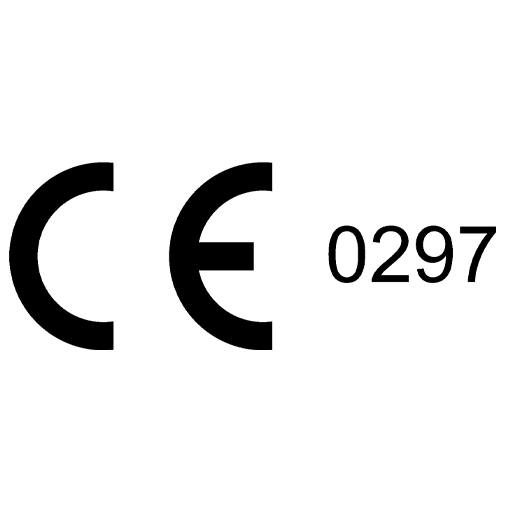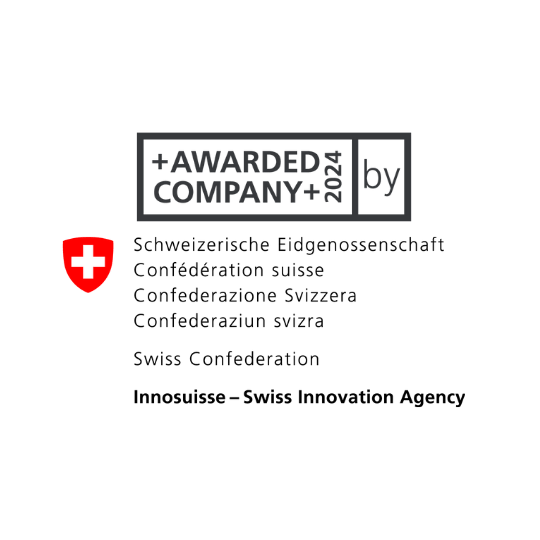Die Brustkrebsforschung hat in den letzten Jahrzehnten bahnbrechende Fortschritte erzielt: Brustkrebs lässt sich heute immer früher erkennen und wesentlich zielgerichteter behandeln. Damit hat die Erkrankung viel von ihrem einstigen Schrecken verloren – ein ernst zu nehmender Gegner ist sie aber immer noch. Ein Rückblick auf die Geschichte der Brustkrebsforschung von der antiken Vier-Säfte-Lehre bis hin zur modernen, personalisierten Onkologie.
Brustkrebs: Seit der Antike bekannt und gefürchtet
Brustkrebs gilt als die älteste überlieferte Krebsart. Bereits aus dem alten Ägypten (2650 v. Chr.) existieren Aufzeichnungen über die Erkrankung, die damals als unheilbar galt. Dass Brustkrebs so lange bekannt ist, hat einen einfachen Grund: Tumore der weiblichen Brust sind tastbar und in späteren Stadien auch nach außen hin sichtbar.
Auch Hippokrates (460 v. Chr.) befasste sich im Rahmen der antiken Vier-Säfte-Lehre intensiv mit Brustkrebs. Als Ursache vermutete er einen Überschuss an schwarzer Galle – möglicherweise aufgrund der dunklen Verfärbungen, die im fortgeschrittenen Stadium häufig durch Einblutungen entstehen. Da sich die Geschwüre krabbenartig im Gewebe zu verankern schienen, gab er ihnen den Namen „karkinos“ (Krabbe, Krebs). Damit war der heutige Übergriff für bösartige Tumore geboren. Von einer Behandlung riet Hippokrates aufgrund der schlechten Prognose ab.
Brustkrebs-Therapien waren lange Zeit martialisch
Andere antike HeilerInnen versuchten dem Krebs u.a. mit Salben aus Insektenfäkalien, Schwefel oder durch das Ausbrennen mit heißen Gegenständen beizukommen. Und obwohl es weder ausreichende Betäubung noch Wunddesinfektion gab, wurden in Einzelfällen auch Operationen vorgenommen. Eine möglichst radikale Entfernung mittels Messer oder Skalpell blieb über viele Jahrhunderte die einzige Chance, den Krebs zu heilen, wenn auch nur mit mäßigem Erfolg: Viele Frauen verstarben anschließend an Wundbrand, andere lehnten die Behandlung aus verständlichen Gründen ab.
Erst 1867 führte der Glasgower Arzt Joseph Lister (1827 – 1912) die erste Brustamputation in Vollnarkose durch. Die Patientin, seine eigene Schwester, verstarb drei Jahre später an Lebermetastasen. Der amerikanische Chirurg William S. Halsted (1852 – 1922) entwickelte die Operationsmethode weiter und postulierte eine maximal radikale Mastektomie: Neben Brustdrüse und Brustmuskel entfernte er auch das umgebende Lymphknotenareal. Die 3-Jahres-Überlebensrate stieg damit von knapp 5 auf immerhin 42 Prozent, viele Patientinnen hatten nach der Prozedur aber mit gravierenden Einschränkungen zu kämpfen.
Ende des 19. Jahrhunderts machte ein schottischer Chirurg namens George T. Beatson (1848 – 1933) eine spannende Entdeckung, die die Brustkrebsforschung voranbrachte: Die operative Entfernung der Eierstöcke brachte bei vielen seiner Patientinnen auch den Brustkrebs in Remission, allerdings nicht bei allen. Damit hatte er das Prinzip der Hormonabhängigkeit von Brustkrebs erfasst, auch wenn die Ursachen dafür noch im Dunklen lagen.
Brustkrebsforschung ab dem 20. Jahrhundert: Eine neue Ära beginnt
Erst im 20. Jahrhundert gelangen in der Brustkrebsforschung entscheidende Durchbrüche: Man begann, die Ursachen von Krebs und das Prinzip der Metastasierung wesentlich besser zu verstehen, was die Entwicklung effektiverer Behandlungen ermöglichte. Ein Meilenstein im Kampf gegen Brustkrebs war schließlich die Einführung von Früherkennungs-Untersuchungen durch Fortschritte in der Röntgentechnik.
Chirurgische Versorgung: Weniger ist mehr
Die radikale Mastektomie nach William S. Halsted beruhte auf der Vorstellung, dass sich Brustkrebs von seinem Entstehungsort aus über Weichteile und Lymphbahnen zentrifugal ausbreitet. Bereits ab den 1930er-Jahren plädierten einzelne Chirurgen wie David H. Patey (1899 – 1977) für weniger radikale Eingriffe ohne Entfernung des Brustmuskels. Trotzdem blieb die Brustamputation über lange Zeit die Standardmethode zur operativen Behandlung des Mammakarzinoms.
Das änderte sich erst ab den 1970er-Jahren, als groß angelegte Studien die Sicherheit weniger radikaler Methoden belegten. Maßgeblich daran beteiligt war die Arbeitsgruppe um den US-amerikanischen Chirurgen Bernard Fisher (1918 – 2019), der das National Surgical Adjuvant Breast Project (NSABP) verantwortete. Dieses auch methodisch fortschrittliche Projekt hat die moderne Brustkrebsforschung über viele Jahrzehnte geprägt.
Im Rahmen experimenteller (prospektiv randomisierter) Studien konnten die Forschenden eindeutig nachweisen, dass brusterhaltende Operationsverfahren mit anschließender Bestrahlung bei kleineren Tumoren ebenso effektiv sind wie die Mastektomie. Auch das Wächterlymphknoten-Konzept, das später zum Standard in der chirurgischen Brustkrebs-Versorgung wurde, geht auf die NSABP-Studien zurück: Ist der Wächterlymphknoten in der Achsel tumorfrei, kann auf die vorsorgliche Entfernung nachgeschalteter Lymphknoten verzichtet werden.
Bessere Behandlungserfolge durch adjuvante Therapien
Bernard Fisher und sein Team vertraten außerdem die Ansicht, dass Brustkrebs nur zu Beginn eine lokale Erkrankung ist, sich später aber im Körper verbreitet – und zwar nicht nur über die Lymphbahnen, sondern auch über den Blutkreislauf. Zwar sollte es noch dauern, bis man in der Brustkrebsforschung das Prinzip der Metastasierung im Detail verstand. Die neue systemische Sichtweise verhalf aber den adjuvanten, also begleitenden Therapien zum Durchbruch. In den 1960er- und 1970er-Jahren waren dies vor allem Chemotherapien und Bestrahlungen. Durch diese neuen, ergänzenden Therapiemethoden konnte Brustkrebs wesentlich effektiver behandelt werden als zuvor. Noch heute gelten Chemotherapie und Strahlentherapie als wirksame Waffen gegen den Krebs. Dank neuerer Präparate und ausgeklügelter Therapieschemata sind sie heute auch wesentlich besser verträglich als zu ihren Anfangszeiten. Dennoch ist durch Chemo- und Strahlentherapien keine zielgerichtete Behandlung von Tumorzellen möglich.
Mammographie und die Geburtsstunde der Früherkennung
Trotz verbesserter Behandlungsmethoden blieb Brustkrebs bis in die 1970er-Jahre eine zumeist tödliche Erkrankung, lediglich die Überlebenszeit verlängerte sich deutlich. Das Problem: Meist wurde der Krebs zu spät entdeckt. Denn wenn Frauen oder ihre ÄrztInnen einen Knoten in der Brust ertasten, hat der Tumor in vielen Fällen bereits gestreut. Könnte es eine Methode geben, um Brustkrebs wesentlich früher aufzuspüren?
Etwa ab den 1960er-/70er-Jahren gelang mit der Einführung der Mammographie als spezieller Röntgentechnik der entscheidende Durchbruch. Experimentiert wurde mit Röntgenaufnahmen der weiblichen Brust bereits seit Jahrzehnten: Der Chirurg Albert Salomon fertigte ab 1913 erste Röntgenbilder von Operationspräparaten an und konnte bereits erklären, wie sich gesundes und krankhaft verändertes Gewebe bildgebend unterscheidet. Die Röntgentechnik der damaligen Zeit war aber noch nicht weit genug für die Anwendung im klinischen Alltag.
Das wurde erst durch technisch verfeinerte Geräte und besser auflösende Filmfolien möglich. Zunächst setzten RadiologInnen die Mammographie nur zu diagnostischen Zwecken an Frauen ein, die an Brustkrebs erkrankt waren oder bei denen der dringende Verdacht bestand. Bald kam jedoch die Idee auf, die Methode auch zur Früherkennung zu nutzen. In New York untersuchte eine Arbeitsgruppe um den Radiologen Philip Strax in einem mit Röntgengerät ausgestatteten Lieferwagen reihenweise Frauen während ihrer Mittagspausen. In Schweden lief ab 1977 ein von der Regierung finanzierte „Two-Country-Trial“-Vorsorgeprogramm an. Dabei wurde Frauen in zwei Bundesländern ein regelmäßiges Mammographie-Screening angeboten. Das Ergebnis ist eines der meistzitierten in der Geschichte der Brustkrebsforschung: Die Brustkrebssterblichkeit unter 50- bis 74-jährigen Frauen reduzierte sich in der Vorsorgegruppe um rund 40 Prozent. Immer mehr Staaten führten danach organisierte Mammographie-Screenings ein, was entscheidend dazu beigetragen hat, Brustkrebs früher erkennen und besser behandeln zu können.
Die Methoden zur Früherkennung von Brustkrebs wurden in den darauffolgenden Jahren immer leistungsfähiger. Heute haben sich u.a. die Tomosynthese, die Sonographie oder die Brust-MRT als nützliche Ergänzungen zur konventionellen Röntgen-Mammographie etabliert.
Hormontherapien und Antikörper-Therapien: Den Tumor gezielt angreifen
Ein weiterer Durchbruch in der Brustkrebsforschung gelang in den 1970er-Jahren mit der Entdeckung von Hormonrezeptoren. Man erkannte, dass viele Tumore Östrogen- bzw. Progesteron-abhängig wachsen, womit erstmals eine molekularbiologische Unterscheidung von Brustkrebs-Unterarten möglich wurde. Mit dem Wirkstoff Tamoxifen stand bald auch schon ein Medikament zur Behandlung von hormonabhängigem Brustkrebs zur Verfügung. Das Wirkprinzip war völlig neu: Anstatt eines ungezielten Rundumschlags wie bei Chemotherapien konnte man den Tumor nun zielgerichtet bekämpfen, ohne gesundes Gewebe zu schädigen.
In den 1980er-Jahren wurde außerdem der zelluläre Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (human epidermal growth factor receptor, HER-2) entdeckt. Er liegt bei rund 15 bis 20 Prozent der Mammakarzinome in mutierter Form vor, wodurch der Krebs ein besonders aggressives Wachstum zeigt. Durch immunologische Techniken war bald schon die Entwicklung eines monoklonalen Antikörpers (Trastuzumab) möglich, der sich gezielt gegen HER-2 richtet. Die Antikörper-Therapie erwies sich bei HER-2-positivem Brustkrebs schnell als sehr erfolgreich, auch bei Patientinnen mit bereits fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs.
Ein wichtiger Schritt war auch die Identifikation verschiedener Genexpressions-Profile um die Jahrtausendwende herum. Dadurch wurde die Systematik auf molekularer Ebene noch einmal deutlich erweitert und verfeinert. Allerdings fehlten zunächst oft noch entsprechend differenzierte „Behandlungswerkzeuge“ – etwa für die triple-negative Variante des Mammakarzinoms, die rund 10 bis 15 Prozent der Fälle ausmacht.
Brustkrebsforschung nimmt die Rolle des Immunsystems ins Visier
Hier zeichnen sich neuerdings Fortschritte ab – und zwar durch die Immuntherapie, die bei anderen Krebsarten schon seit längerer Zeit erfolgreich im Einsatz ist. Ihr Grundprinzip: Man bekämpft die Tumorzellen nicht direkt, sondern nimmt ihnen ihre Tarnung, durch die sie sich dem Immunsystem entziehen. Dadurch ist das Immunsystem wieder in der Lage, die Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren. Neueste Studien belegen, dass eine ergänzende Immuntherapie bei einem Teil der Patientinnen mit triple-negativem Brustkrebs gute Wirkung zeigt. Viele Forschende betrachten die Immuntherapie bereits heute als vierte Säule der medikamentösen Brustkrebs-Behandlung – neben Chemotherapie, Antihormon-Therapien und Antikörper-Therapien. Ihr differenzierter Einsatz bei verschiedenen Brustkrebs-Typen wird derzeit intensiv erforscht.
Brustkrebsforschung von morgen: Personalisiert und digitalisiert
Die Erkenntnis, dass es nicht den einen Brustkrebs gibt, sondern viele verschiedene Typen, hat die Brustkrebsforschung der letzten Jahrzehnte entscheidend geprägt. Sie hat auch den Weg für personalisierte Therapien geebnet und damit dazu beigetragen, die Sterblichkeit an Brustkrebs weiter zu reduzieren. So liegt die 5-Jahres-Überlebensrate mittlerweile bei über 90 Prozent.
Doch das Potenzial der personalisierten Krebsmedizin ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die aktuelle Brustkrebsforschung beschäftigt sich intensiv mit Ansätzen wie
- individualisierten Früherkennungs- und Screening-Strategien
- der Identifikation weiterer Biomarker als Ansatzpunkte für eine verbesserte Prognostik und zielgerichtete Therapien
- genomischen und molekularen Tests zur Ermittlung eines individuellen Risikoprofils
- therapeutischen „Krebsimpfungen“ zur Aktivierung des Immunsystems
Die Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs werden dadurch immer zielgerichteter, aber auch immer komplexer. Künftig wird daher vor allem die Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielen. Die enormen Datenmengen, die durch bildgebende Untersuchungen, Gentests und histologische Auswertungen anfallen, lassen sich nur durch leistungsfähige IT-Lösungen wie Künstlicher Intelligenz effektiv nutzen.
Durch die Erfolge der Brustkrebsforschung ist das Mammakarzinom über die Jahrhunderte von einem nahezu sicheren Todesurteil zu einer prinzipiell gut behandelbaren Erkrankung geworden. Innovative Methoden der Früherkennung, Diagnostik und Behandlung werden künftig eine noch bessere Versorgung der Patientinnen ermöglichen.