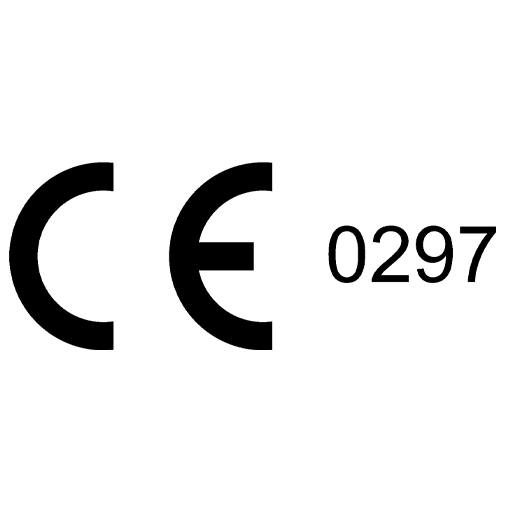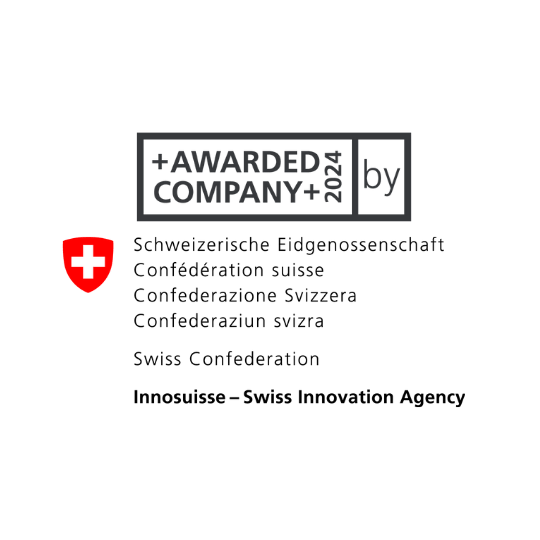Die staatlich organisierte Brustkrebs-Früherkennung ist ein klares Erfolgsprojekt: Seit der Einführung gesetzlicher Screening-Programme versterben nachweislich weniger Frauen an Brustkrebs. Doch nach wie vor gibt es Verbesserungspotenziale, denn die standardisierten Screenings sind nicht für jede Frau optimal. Aktuelle Studien zeigen, wie die Brustkrebs-Früherkennung methodisch verfeinert und personalisiert werden kann. Effizientere Workflows könnten auch radiologische Einrichtungen entlasten.
Herausforderungen in der Brustkrebs-Früherkennung
Seit den 1990er-Jahren wurden in den USA und in Europa mehr und mehr flächendeckende Brustkrebs-Screeningprogramme ausgerollt. Die genauen Altersgrenzen und Untersuchungsintervalle unterscheiden sich von Land zu Land. In der Regel wird Frauen zwischen 50 und 70 Jahren in ein- bis zweijährigen Abständen eine Untersuchung der Brust empfohlen.
Die Mammographie ist als Standard-Untersuchung zur Brustkrebs-Früherkennung breit verfügbar, relativ kostengünstig und ihr Nutzen ist wissenschaftlich belegt. Dennoch ist die Methode nicht perfekt: Teils werden Tumore übersehen, teils erhalten Frauen falsch-positive Befunde, die beunruhigen und weitere belastende Untersuchungen nach sich ziehen. Auch die erforderliche Kompression der Brust kann mitunter schmerzhaft sein und hält viele Frauen von einer Teilnahme ab.
Auf der anderen Seite stehen viele Institute, die das gesetzliche Mammographie-Screening anbieten, unter erheblichem Druck. Denn die Arbeitsbelastung durch die Früherkennungs-Untersuchungen ist enorm, die gesetzlich definierten Anforderungen sind hoch. Fehlendes Personal und knappe finanzielle Ressourcen machen es zunehmend zur Herausforderung, die obligatorischen Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten.
Wie also lassen sich die etablierten Screening-Programme verbessern, damit Teilnehmerinnen einen höheren persönlichen Nutzen daraus ziehen? Und wie könnten radiologische Einrichtungen zugleich entlastet werden, ohne dass die Qualität der Screenings darunter leidet? Forschungsteams arbeiten weltweit mit Hochdruck an Lösungen, um die Brustkrebs-Früherkennung in medizinischer Hinsicht zu verbessern und organisatorisch effizienter zu gestalten.
ToSyMa-Studie: Digitale Tomosynthese erkennt mehr Karzinome
Die digitale Mammographie als Röntgen-Untersuchung der weiblichen Brust ist derzeit die Standard-Methode in der organisierten Brustkrebs-Früherkennung. Doch gerade bei Frauen mit hoher mammographischer Brustdichte liefert sie oft unklare Ergebnisse. Denn durch Überlagerungseffekte können einerseits Auffälligkeiten vorgetäuscht werden, andererseits lassen sich kleinere Tumore leicht übersehen.
In der groß angelegten ToSyMa-Studie an der deutschen Universität Münster wird derzeit untersucht, inwieweit die digitale Brust-Tomosynthese (DBT) die Brustkrebs-Früherkennung voranbringt. Der Hintergrund: Die Tomosynthese ist ein weiterentwickeltes röntgenbasiertes Verfahren zur Schichtuntersuchung der Brust, die eine überlagerungsfreie Darstellung der Gewebestrukturen ermöglicht. Sie wirkt damit den typischen Schwächen der herkömmlichen Mammographie entgegen. Um den Vergleich mit Voraufnahmen und eine visuelle Beurteilung der Brustdichte zu ermöglichen, lässt sich aus den generierten Pseudo-3D-Datensätzen eine synthetische 2-Ebenen-Mammographie errechnen.
Im Rahmen der ToSyMa-Studie wurden knapp 100.000 Frauen rekrutiert, um die Kombination aus DBT plus 2D-Mammographie mit der bisherigen Standardmethode zu vergleichen. Die Auswertungen sind noch nicht abgeschlossen, doch erste Ergebnisse deuten auf erhebliche Vorteile der innovativen Technologie hin: Insgesamt war die Detektionsrate von invasivem Brustkrebs mit DBT plus 2D-Mammographie um 48 Prozent erhöht. Bei Teilnehmerinnen mit extrem dichtem Brustgewebe (ACR-Kategorie d) zeigte sich die Tomographie mit einer um fast 250 Prozent erhöhten Detektionsrate sogar deutlich überlegen.
In Phase 2 der ToSyMa-Studie stehen nun die Langzeiteffekte der verbesserten Brustkrebs-Früherkennung auf dem Prüfstand, indem u.a. Daten aus dem nationalen Krebsregister ausgewertet werden sollen.
Bei dichtem Brustgewebe: DENSE-Studie zeigt Vorteile der MRT
Frauen mit hoher Brustdichte, d.h. einem hohen Anteil an mammographisch dichtem Brustdrüsengewebe, haben ein etwa zwei- bis vierfach erhöhtes Brustkrebsrisiko. Zugleich ist die röntgenbasierte Mammographie bei ihnen deutlich weniger treffsicher. Als alternatives Verfahren bietet sich neben der digitalen Brust-Tomographie insbesondere die kontrastmittelunterstützte Magnetresonanztomographie (MRT) an. Der Nachweis von invasivem Brustkrebs mittels MRT gelingt im Wesentlichen durch die Erfassung einer lokal vermehrten Durchblutung, wie sie vor allem für schnell wachsende, aggressive Tumore typisch ist. Dadurch zeigt die MRT andere Tumoreigenschaften auf als die röntgenbasierten Verfahren. Eine Kompression der Brust ist für die MRT-Untersuchung nicht erforderlich.
Welchen Mehrwert die MRT bei der Brustkrebs-Früherkennung speziell für Frauen mit dichtem Brustgewebe bietet, ist Gegenstand der niederländischen DENSE-Studie. Mehr als 40.000 Frauen mit sehr dichtem Brustgewebe (ACR-Kategorie d) wurde randomisiert eine ergänzende Mamma-MRT angeboten, 59 Prozent nahmen das Angebot an. Das Ergebnis: Die Karzinom-Detektionsrate lag in der Gruppe der MRT-Teilnehmerinnen mit 16,5 pro 1000 deutlich über jener in der Kontrollgruppe (6,0 pro 1000). Außerdem konnte die Intervallkarzinomrate von 5,0 pro 1000 in der Kontrollgruppe auf 2,5 pro 1000 in der MRT-Gruppe gesenkt werden.
Allerdings gehen mit der besseren Detektion auch mehr falsch-positive Befunde einher. So lag die Rückrufrate in der DENSE-Studie bei knapp 10 Prozent, während sie in Mammographie-Screening-Programmen normalerweise rund 3 Prozent beträgt. Von jenen Frauen, die anschließend eine Biopsie erhielten, hatten 26,3 Prozent tatsächlich einen invasiven Tumor, in fast 3 von 4 Fällen wurde also falscher Alarm ausgelöst.
Die geringe Spezifität, aber auch die höheren Kosten und der zeitliche Aufwand sprechen derzeit gegen eine breite Anwendung der MRT in der Brustkrebs-Früherkennung. Gerade für Risikopatientinnen oder bei hoher Brustdichte könnte die Methode aber eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zur Mammographie darstellen.
Wie automatisierter Brust-Ultraschall durch künstliche Intelligenz verbessert werden kann
Als komplementäres bildgebendes Verfahren hat die Sonographie in der Brust-Diagnostik seit Jahrzehnten ihren fixen Platz. Bei jungen Frauen ist die Sonographie in der Regel die erste Untersuchung bei einem konkreten Verdacht, und auch bei unklaren Mammographie-Befunden greifen ÄrztInnen häufig zum Ultraschall. Ebenso wie bei der MRT muss die Brust nicht komprimiert werden.
Aktuell kommen ergänzende Ultraschall-Untersuchungen im organisierten Brustkrebs-Screening (mit Ausnahme von Österreich) jedoch nicht systematisch zum Einsatz. Ein möglicher Nachteil der Methode ist, dass die Ergebnisse stark von der Erfahrung des ärztlichen Personals abhängen.
Als Alternative zur herkömmlichen Sonographie sind seit einigen Jahren automatisierte 3D-Ultraschall-Systeme (ABUS) verfügbar, die speziell für die Anwendung bei dichtem Brustdrüsengewebe konzipiert wurden. Diese Systeme erlauben eine standardisierte Brust-Sonographie mit reproduzierbaren Ergebnissen. Die Untersuchung selbst kann an geschulte MTAs delegiert werden und ist dank des automatisierten Verfahrens in wenigen Minuten abgeschlossen. Allerdings erzeugt der automatisierte 3D-Ultraschall eine große Anzahl an Aufnahmen, was für das ärztliche Personal einen erhöhten Zeitaufwand bei der Befundung zur Folge haben kann.
Ein Forschungsteam der Universität Zürich, an dem auch b-rayZ‘ Cristina Rossi, Andreas Boss und Alexander Ciritsis beteiligt waren, hat sich nun daran gemacht, diese Lücke mittels KI zu schließen. In einer retrospektiven Studie wurde ein künstliches neuronales Netzwerk mithilfe von 645 ABUS-Datensets von insgesamt 113 Patientinnen trainiert, zwischen normalen und abnormalen Ultraschall-Befunden zu unterscheiden und verdächtige Bereiche hervorzuheben.
Das Ergebnis: Die trainierten KI-Modelle können als unabhängiges Zweitmeinungsinstrument bei ABUS-Untersuchungen nach dem BI-RADS-Katalog standardisiert werden. Das neuronale Netz war in der Lage, Auffälligkeiten im Brust-Ultraschall mit ähnlicher Genauigkeit wie erfahrene RadiologInnen zu erkennen und einzuordnen. Die Implementierung der entwickelten KI-Modelle in die Untersuchungen ermöglicht damit eine zuverlässigere Beurteilung der Ergebnisse und reduziert die Arbeitsbelastung für RadiologInnen.
MyPeBS und WISDOM: Auf dem Weg zur individualisierten Brustkrebs-Früherkennung
Die meisten staatlich organisierten Screening-Programme in den USA und Europa verfolgen einen „One fits all“-Ansatz: Altersgrenzen und Screening-Intervalle sind einheitlich definiert, ohne das individuelle Risiko der jeweiligen Frau zu berücksichtigen. Lediglich Frauen mit nachgewiesener erblicher Hochrisikokonstellation erhalten oft Zugang zu intensivierten Früherkennungs-Untersuchungen.
Doch das Brustkrebs-Risiko ist nicht für jede Frau gleich. Genetische Veranlagung, hormonelle Faktoren, BMI oder Lebensstil spielen hinein. Die Wissenschaft diskutiert daher intensiv personalisierte Früherkennungs-Strategien. Die Grundidee: Indem man Frauen einen individuell adaptierten Screening-Fahrplan anbietet, könnte der potenzielle Nutzen – also die Brustkrebs-Detektionsrate – erhöht werden, während der Anteil falsch-positiver Befunde sinkt.
Zur Bestimmung des individuellen Brustkrebs-Risikos stehen verschiedene Risikomodelle zur Verfügung. Einige stützen sich primär auf genetische Faktoren, andere beziehen zusätzliche Daten wie die Brustdichte oder den Zeitpunkt von Menarche und Menopause mit ein. Die eingesetzten mathematischen Modelle werden laufend validiert und verbessert.
In den USA und in Europa sind in den letzten Jahren zwei große Studien über den Nutzen eines risikoadaptierten Screenings im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren gestartet. Seit 2016 läuft die „Women Informed to Screen Depending on Measures of Risk“ (WISDOM)-Studie in den USA, für die mehr als 60.000 Frauen rekrutiert wurden. Gut 17.000 von ihnen erhalten auf der Basis genetischer und klinischer Risikofaktoren individuelle Screening-Empfehlungen.
In Europa wurde 2019 die von der Europäischen Kommission geförderte „My Personal Breast Screening“ (MyPeBR) lanciert, an der etwa 85.000 Frauen im Alter von 40 bis 70 Jahren teilnehmen. Sie soll detaillierte Informationen über mögliche Vor- und Nachteile eines risikostratifizierten Screenings liefern. Eine Teilstudie setzt sich intensiv mit den psychologischen, sozioökonomischen und ethischen Auswirkungen eines personalisierten Screenings auseinander.
Endgültige Ergebnisse stehen noch aus, doch es zeigt sich bereits: Eine individualisierte Brustkrebs-Früherkennung auf Basis des persönlichen Risikos ist prinzipiell umsetzbar. Ihr Nutzen, mögliche Nachteile und Risiken, die Kosteneffizienz und nicht zuletzt die Akzeptanz von Seiten der Frauen müssen noch intensiv erforscht werden.
Neue Technologien und Strategien können Brustkrebs-Früherkennung verbessern
Es gibt klare Evidenz dafür, dass sich die staatlich organisierten Screening-Programme weiter verbessern und optimieren lassen. Ein möglicher Ansatzpunkt ist die Weiterentwicklung bildgebender Verfahren, um so die Schwächen der konventionellen Mammographie zu kompensieren. Zugleich könnten radiologische Einrichtungen durch eine zunehmende Standardisierung und Automatisierung von Prozessen entlastet werden.
Eine weitere vielversprechende Option für die Brustkrebs-Früherkennung sind personalisierte Screening-Strategien auf der Basis des individuellen Risikoprofils. Sie könnten möglicherweise eine verbesserte Kosten-Nutzen-Bilanz für die einzelne Teilnehmerin bewirken, indem sie dazu beitragen, mehr Tumore in frühen Stadien zu entdecken und zugleich falsch-positive Befunde zu vermeiden.